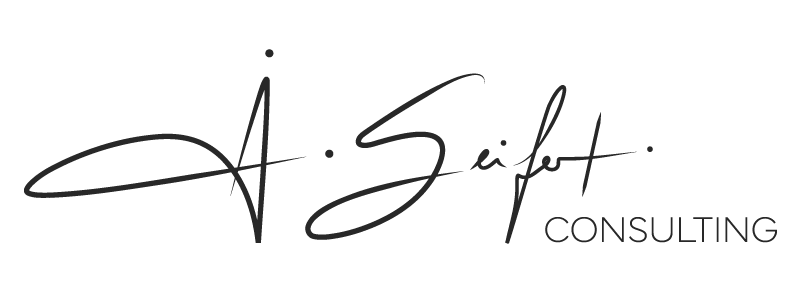Donor Journey vs. Spenderpyramide: Was ist der Unterschied und wie kombiniert man beide Ansätze?
Im Fundraising gibt es viele Modelle, die darauf abzielen, Spender langfristig zu binden und ihr Engagement zu maximieren. Zwei besonders zentrale Konzepte sind die Donor Journey und die Spenderpyramide. Während die Donor Journey den strukturierten Weg beschreibt, den ein Spender von der ersten Interaktion bis hin zu wiederholten Spenden durchläuft, visualisiert die Spenderpyramide, wie sich das Engagement eines Spenders über die Zeit hinweg vertieft. Beide Modelle spielen eine wichtige Rolle im Fundraising – doch was genau ist der Unterschied zwischen ihnen, und wie lassen sich diese Ansätze kombinieren?
In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Donor Journey und die Spenderpyramide, beleuchten die Kritikpunkte am Pyramidenmodell und zeigen, wie NGOs von einer kombinierten Anwendung profitieren können.
Was ist die Donor Journey?
Die Donor Journey, wie im Artikel "Was ist eine Donor Journey und wie kann ich sie mir zu Nutze machen?" beschrieben, ist der Prozess, den ein Spender durchläuft – von der ersten Interaktion mit einer Organisation bis hin zu einer tiefen, langfristigen Bindung. Sie ist in verschiedene Phasen unterteilt: vom ersten Kontakt (Bewusstsein) über die Spendenentscheidung bis hin zur regelmäßigen Unterstützung und Loyalität.
Die Donor Journey konzentriert sich auf die Spendererfahrung in jeder Phase dieser Reise und stellt sicher, dass jede Interaktion gezielt gestaltet wird, um den Spender langfristig zu binden. Es geht darum, die passenden Botschaften zur richtigen Zeit zu vermitteln und Spender so zu motivieren, sich stärker zu engagieren.
Was ist die Spenderpyramide?
Die Spenderpyramide (oder Fundraising-Pyramide) ist ein klassisches Modell im Fundraising, das den Prozess beschreibt, wie sich Spender im Laufe der Zeit von einmaligen Unterstützern zu treuen Spendern und schließlich zu Großspendern entwickeln. Dabei basiert die Pyramide auf der Vorstellung, dass die Anzahl der Spender mit zunehmender Spendenhöhe und -häufigkeit abnimmt.
Die Spenderpyramide wird in mehreren Modellen verwendet. In der klassischen Form besteht sie aus folgenden Ebenen:
Basis-Ebene (einmalige Spender): Diese Ebene umfasst die meisten Spender, die einmalige, kleinere Beträge spenden.
Mittlere Ebene (regelmäßige Spender): In dieser Ebene finden sich weniger Spender, die jedoch regelmäßig oder in wiederkehrenden Zyklen spenden.
Spitzen-Ebene (Großspender): Die kleinste Gruppe von Spendern, die jedoch signifikante Beträge spenden oder die Organisation durch testamentarische Zuwendungen oder größere Förderungen unterstützen.
In einigen Modellen der Spenderpyramide gibt es noch eine zusätzliche Ebene unterhalb der Basis, die sich auf Interessenten oder potenzielle Spender bezieht. Diese Personen haben die Organisation vielleicht kennengelernt, aber noch keine Spende getätigt.
Kritikpunkte an der Spenderpyramide
Obwohl die Spenderpyramide im Fundraising häufig verwendet wird, gibt es auch einige Kritikpunkte an diesem Modell. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass die Pyramide eine lineare, einseitige Entwicklung darstellt, bei der Spender von einer Stufe zur nächsten aufsteigen. In der Praxis verläuft das Engagement jedoch oft nicht so geradlinig. Ein Spender, der einmal eine größere Spende getätigt hat, könnte sich später nur sporadisch beteiligen oder sogar wieder auf die Basis-Ebene zurückfallen. Die starre Struktur der Pyramide berücksichtigt diese dynamischen Entwicklungen nicht ausreichend.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Spenderpyramide sich stark auf Finanzierung und Spendenhöhe konzentriert, jedoch weniger auf das Gesamterlebnis des Spenders oder die Qualität der Beziehung zur Organisation. Während die Pyramide eine wertvolle Visualisierung bietet, um den finanziellen Beitrag der Spender zu verstehen, bleibt sie in ihrer Aussage über die langfristige Beziehung zwischen Spender und Organisation eher oberflächlich.
Deshalb reicht es oft nicht aus, nur auf die Spenderpyramide zu vertrauen. Sie ist ein klassisches Modell, das im Fundraising eine wichtige Rolle spielt, aber es sollte immer mit weiteren Konzepten, wie der Donor Journey, kombiniert werden, um eine ganzheitliche Fundraising-Strategie zu entwickeln.
Der Unterschied zwischen Donor Journey und Spenderpyramide
Die Donor Journey und die Spenderpyramide unterscheiden sich in ihrem Ansatz und Fokus:
Die Donor Journey ist prozessorientiert und beschreibt die "Reise" des Spenders, vom ersten Kontakt bis hin zu langfristiger Unterstützung. Sie konzentriert sich darauf, wie Spender in jeder Phase der Reise begleitet werden und stellt sicher, dass sie eine positive Erfahrung machen.
Die Spenderpyramide ist ergebnisorientiert und zeigt, wie Spender durch gezielte Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen der Pyramide aufsteigen können. Der Fokus liegt auf der Steigerung des finanziellen Engagements.
Während die Donor Journey den Weg beschreibt, den ein Spender nimmt, visualisiert die Spenderpyramide das Ziel, nämlich die Entwicklung vom einmaligen Spender hin zum Großspender.
Wie man die Donor Journey und die Spenderpyramide kombiniert
Obwohl Donor Journey und Spenderpyramide unterschiedliche Schwerpunkte haben, können sie hervorragend kombiniert werden, um eine ganzheitliche Fundraising-Strategie zu entwickeln. Hier sind einige Ansätze, wie du beide Modelle nutzen kannst:
Die Donor Journey als Leitfaden durch die Pyramide
Die Donor Journey kann genutzt werden, um Spender von einer Ebene der Spenderpyramide zur nächsten zu führen. Indem du verstehst, wo sich ein Spender in seiner Reise befindet – sei es beim ersten Kontakt oder als wiederholter Unterstützer – kannst du gezielte Maßnahmen ergreifen, um ihn tiefer in die Pyramide zu führen.
Beispiel: Ein Spender, der gerade seine erste Spende getätigt hat, steht auf der untersten Ebene der Pyramide. Du kannst ihn durch personalisierte Danksagungen, regelmäßige Updates und transparente Informationen motivieren, regelmäßiger Unterstützer zu werden.
Segmentierung entlang der Pyramide
Die Spenderpyramide bietet eine klare Struktur zur Segmentierung deiner Spender. Dies hilft dir, die Donor Journey für jede Gruppe individuell zu gestalten. Ein Spender auf der Basis-Ebene benötigt andere Informationen und Anreize als ein regelmäßiger Spender oder Großspender.
Durch eine angepasste Kommunikation an jede Ebene der Pyramide kannst du sicherstellen, dass jeder Spender die richtigen Botschaften zur richtigen Zeit erhält.
Langfristige Strategie durch die Pyramide
Während die Donor Journey dir hilft, die kurzfristigen Maßnahmen für jeden Spender zu gestalten, gibt dir die Spenderpyramide eine langfristige Vision, wie du Spender weiterentwickeln kannst. Das Ziel ist es, Spender auf ihrer Reise zu begleiten und ihre Bindung zu vertiefen, sodass sie über die Zeit hinweg zu Großspendern werden.
Indem du regelmäßig überprüfst, wo sich deine Spender in der Pyramide befinden und welche Maßnahmen dazu führen könnten, dass sie aufsteigen, kannst du deine Fundraising-Strategie langfristig und nachhaltig gestalten.
Praxisbeispiel: Die Kombination von Donor Journey und Spenderpyramide
Ein Spender, der an einer Online-Kampagne teilnimmt und 20 Euro spendet, hat den ersten Schritt auf der Donor Journey gemacht und steht auf der untersten Ebene der Spenderpyramide. Durch regelmäßige Kommunikation und Updates über die Wirkung seiner Spende kannst du ihn dazu motivieren, erneut zu spenden und sich langfristig stärker zu engagieren. Mit der Zeit könnte dieser Spender zu einem regelmäßigen Unterstützer werden, der in der Spenderpyramide aufsteigt.
Fazit
Die Donor Journey und die Spenderpyramide sind zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Konzepte, die NGOs helfen, Spenderbeziehungen strategisch zu entwickeln. Während die Donor Journey den Weg des Spenders von der ersten Interaktion bis zur langfristigen Bindung beschreibt, zeigt die Spenderpyramide, wie sich das Engagement im Laufe der Zeit vertiefen kann. Beide Ansätze zusammen bieten eine umfassende Fundraising-Strategie, die sicherstellt, dass du deine Spender nicht nur einmal gewinnst, sondern langfristig an deine Organisation bindest.