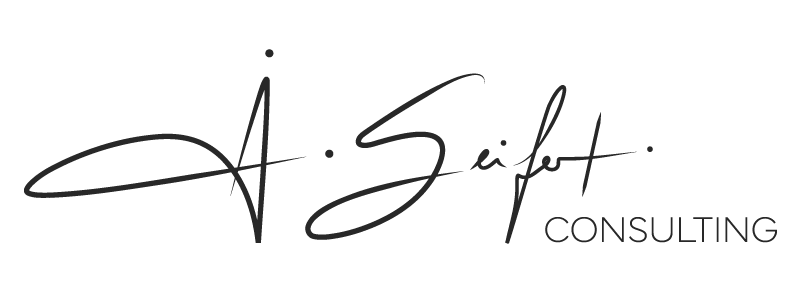Der Paradigmenwechsel: Vom Bitten zum Ermöglichen
Fundraising war schon immer Ausdruck von Beziehung – zwischen Menschen, die etwas bewirken wollen, und Organisationen, die dafür Strukturen schaffen. Doch die Art, wie diese Beziehung beschrieben und gelebt wird, verändert sich. Über Jahrzehnte war Fundraising vor allem durch eine sogenannte „Bittstellenden-Logik“ geprägt: Eine Organisation erklärt ein Problem, ruft zu Hilfe auf und bittet um Spenden, um etwas zu verändern. Dieses Modell hat Großartiges ermöglicht – zahllose Projekte, Kampagnen und gesellschaftliche Entwicklungen wären ohne diese Form des Gebens nicht denkbar gewesen.
Gleichzeitig verändert sich unsere gesellschaftliche Haltung zum Engagement. Immer mehr Menschen verstehen sich nicht nur als Unterstützer:innen, sondern als Mitgestaltende. Sie wollen Teil einer Lösung sein, nicht nur Beobachter:innen eines Problems. Damit rückt eine neue Denkweise in den Mittelpunkt, die man als „Ermöglichungs-Logik“ beschreiben kann. Sie verlagert den Schwerpunkt: Weg von der Bitte, hin zur Einladung, gemeinsam zu handeln.
Das bedeutet nicht, dass Bitten falsch war oder ist. Es bedeutet, dass Fundraising als Beziehung weiterwächst. Während früher das Geben im Vordergrund stand, geht es heute stärker um das Mitwirken – darum, Menschen einzuladen, Verantwortung zu teilen und Teil eines gemeinsamen Wirkungsprozesses zu werden.
In dieser Logik wird Fundraising nicht mehr als Transaktion verstanden – also als Tausch von Geld gegen gutes Gewissen –, sondern als gemeinsamer Gestaltungsprozess. Spenden werden nicht „gegeben“, sondern ermöglichen, dass etwas passiert. Wer spendet, wird Teil einer Bewegung, die an einer Lösung arbeitet. Das verändert Sprache, Haltung und Kommunikation.
Organisationen, die in dieser neuen Logik denken, erzählen ihre Geschichten anders. Sie sprechen weniger über Mangel und mehr über Potenzial. Sie zeigen, was bereits möglich geworden ist – und was durch gemeinsames Handeln noch entstehen kann. Sie erzeugen nicht Schuldgefühle, sondern Selbstwirksamkeit. Und sie kommunizieren Wirkung nicht als Ergebnis, sondern als fortlaufenden Prozess, an dem viele beteiligt sind.
Diese Verschiebung ist kein Bruch mit dem klassischen Fundraising, sondern eine Weiterentwicklung. Die Beziehung zwischen Organisation und Spender:in wird stabiler, weil sie auf gegenseitigem Vertrauen und Mitgestaltung basiert. Menschen, die sich beteiligt fühlen, bleiben länger verbunden, weil sie ihre eigene Wirksamkeit erleben. Für Organisationen bedeutet das, ihre Kommunikation bewusster zu gestalten: weniger als Appell, mehr als Einladung; weniger als Transaktion, mehr als gemeinsame Verantwortung.
Fundraising im Jahr 2026 ist damit nicht mehr nur das Bitten um Unterstützung. Es ist das Angebot, Teil einer Veränderung zu sein. Es geht nicht darum, Mittel zu sichern, sondern Möglichkeiten zu öffnen – für Wirkung, Gemeinschaft und Beteiligung.
Diese Entwicklung stellt Organisationen vor neue Fragen: Wie können wir Mitgestaltung konkret ermöglichen? Wie schaffen wir Räume für Beteiligung, ohne unsere eigenen Strukturen zu überfordern? Wie kommunizieren wir, damit aus Unterstützung Beziehung entsteht?
Darauf gibt es keine einfache Antwort, aber eine klare Richtung: Fundraising, das auf Ermöglichung setzt, wächst aus Vertrauen, Transparenz und gemeinsamem Sinn. Es stärkt die Zivilgesellschaft nicht nur finanziell, sondern kulturell – weil es zeigt, dass Wirkung kein Produkt ist, sondern eine Haltung.
Vielleicht ist das der eigentliche Paradigmenwechsel: Fundraising wird nicht mehr als Bitte verstanden, sondern als Einladung, Zukunft gemeinsam zu gestalten.